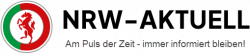Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen gehört zu den prägenden Institutionen für moderne und zeitgenössische Kunst in Deutschland. Sie ist eng verknüpft mit der Geschichte des Bundeslandes, mit kulturpolitischen Entscheidungen der Nachkriegszeit und mit einer Reihe von Persönlichkeiten, die mit großem Blick für Qualität eine Sammlung von internationalem Rang aufgebaut haben. Was heute selbstverständlich wirkt – mehrere Häuser, ein umfangreicher Bestand von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart, ein dichtes Ausstellungsprogramm – begann mit einem einzelnen, spektakulären Ankauf.
Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre suchte das junge Bundesland Nordrhein-Westfalen nach einem kulturellen Profil, das über einzelne Theater, Museen und Orchester hinausreicht. Der Erwerb einer größeren Werkgruppe von Paul Klee war dabei mehr als ein Kunstkauf. Er war ein Bekenntnis zur Moderne und ein Zeichen dafür, dass ein Bundesland sich bewusst auf die internationale Kunst des 20. Jahrhunderts einlässt. Aus einer geschlossenen Sammlung von 88 Arbeiten entstand der Keim für eine eigenständige Landessammlung, die sich in den folgenden Jahrzehnten immer weiter vergrößerte.
Heute umfasst die Kunstsammlung NRW mehrere Standorte in Düsseldorf: K20 am Grabbeplatz, K21 im ehemaligen Ständehaus sowie das Schmela Haus in der Altstadt. Jeder Ort besitzt eine eigene Atmosphäre, eine eigene Architektur und unterschiedliche Schwerpunkte. Zusammen erzählen diese Häuser die Entwicklung von der klassischen Avantgarde bis zur experimentellen Kunst der Gegenwart und spiegeln zugleich die Geschichte einer Region, die von Industrie, Strukturwandel, Internationalität und einer lebendigen Kunstszene geprägt ist.
Die Kunstsammlung ist Ausstellungshaus, Forschungsinstitut, Ort der Vermittlung und nicht zuletzt ein Treffpunkt für Kunstinteressierte aus aller Welt. Sie knüpft an die reiche Tradition Düsseldorfs als Kunststadt an – von der Kunstakademie über bedeutende Galerien bis hin zu den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die hier gearbeitet haben oder noch immer arbeiten. Gerade in der Verbindung von historischer Sammlung, zeitgenössischer Produktion und kulturpolitischer Verantwortung liegt der besondere Reiz dieser Institution.
Die ersten Jahre: Ein Bundesland schafft sich eine Sammlung
Der Ankauf der Klee-Werke 1960
Der offizielle Beginn der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen lässt sich ziemlich genau datieren: 1960 erwarb das Land 88 Werke von Paul Klee aus der Sammlung des amerikanischen Industriellen G. David Thompson. Der Kauf wurde vom Basler Galeristen Ernst Beyeler vermittelt und war für die damalige Zeit ein spektakuläres kulturpolitisches Signal. Mit einem Schlag verfügte Nordrhein-Westfalen über eine der bedeutendsten Klee-Gruppen außerhalb der Schweiz und positionierte sich sichtbar im internationalen Kunstfeld.
Paul Klee, dessen Werk stilistisch zwischen Expressionismus, Bauhaus, Surrealismus und eigener poetischer Bildsprache steht, verkörperte eine moderne Kunstauffassung, die sich klar vom akademischen Kanon des 19. Jahrhunderts abhob. Die nun in Düsseldorf beheimatete Werkgruppe umfasste Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, die ganz unterschiedliche Schaffensphasen des Künstlers abdeckten. Sie bot damit eine ideale Grundlage für eine Sammlung, die nicht auf regionale Traditionen beschränkt bleiben, sondern in einen größeren Zusammenhang gestellt werden sollte.
Die Gründung der Stiftung im Jahr 1961
Auf den Ankauf folgte 1961 die Gründung der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Trägerin wurde das Land, Sitz der Einrichtung die Landeshauptstadt Düsseldorf. Die junge Stiftung hatte den Auftrag, Kunst des 20. Jahrhunderts von internationalem Rang zu sammeln, zu erforschen und öffentlich zu präsentieren. Damit wurde der Klee-Ankauf institutionell eingebettet und zu einer dauerhaften Aufgabe ausgebaut.
Zunächst war die Sammlung in wechselnden Räumen untergebracht, unter anderem im Schloss Jägerhof. Die provisorische Situation hinderte die Verantwortlichen jedoch nicht daran, den Bestand weiter auszubauen. Schritt für Schritt kamen Werke der Klassischen Moderne hinzu: Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Piet Mondrian, Max Beckmann und viele andere begründeten das Profil einer Sammlung, die sich bewusst an den großen internationalen Museumshäusern orientierte.
Werner Schmalenbach und der Aufbau der Klassischen Moderne
Eine Schlüsselfigur der frühen Jahre war Werner Schmalenbach, der 1962 die Leitung übernahm und die Kunstsammlung bis 1990 prägte. Er verstand das Haus als Museum der Klassischen Moderne und konzentrierte sich auf einzelne herausragende Werke, statt auf enzyklopädische Vollständigkeit zu setzen. Entscheidend war für ihn die künstlerische Qualität und der dialogische Zusammenhang der Arbeiten untereinander.
Auf dieser Grundlage entstand ein klar strukturiertes Bild der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, mit starken Gruppen zu Kubismus, Expressionismus und abstrakter Kunst. Zugleich öffnete sich die Kunstsammlung zunehmend der internationalen Nachkriegsavantgarde, von abstraktem Expressionismus bis zur frühen Konzeptkunst. Schon in dieser Phase wurde sichtbar, dass das Haus nicht nur ein Depot historischer Meisterwerke sein wollte, sondern eine lebendige Institution, die Gegenwärtiges ernst nimmt.
K20 am Grabbeplatz: Die Bühne der Moderne
Architektur und Eröffnung 1986
Mit der wachsenden Sammlung wurde klar, dass eine dauerhafte Lösung für Präsentation und Lagerung gefunden werden musste. 1986 eröffnete schließlich das K20 am Grabbeplatz, entworfen vom dänischen Architekturbüro Dissing+Weitling. Das Gebäude mit seiner geschwungenen Fassade aus dunklem Granit setzt einen markanten Akzent im Stadtzentrum und grenzt unmittelbar an die Altstadt an.
Innen zeichnet sich K20 durch großzügige, lichtdurchflutete Räume aus, in denen Oberlichter und klare Raumfolgen den Blick auf die Kunst lenken. Die Architektur schafft einen ruhigen Rahmen, in dem Bilder und Skulpturen in verschiedenen Konstellationen gezeigt werden können. Spätere Erweiterungen und Umbauten haben diese Qualitäten verstärkt und zugleich die technischen Bedingungen für internationale Großausstellungen verbessert.
Schwerpunkte der Sammlung im K20
Im K20 konzentriert sich die Präsentation auf Kunst vom frühen 20. Jahrhundert bis in die jüngere Gegenwart. Neben der großen Klee-Gruppe finden sich zentrale Werke von Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Max Beckmann, Piet Mondrian und vielen anderen Vertretern der historischen Avantgarden. Hinzu kommen herausragende Arbeiten der amerikanischen Nachkriegskunst, etwa von Jackson Pollock, Mark Rothko, Andy Warhol oder Roy Lichtenstein.
Die Zusammenstellung zeigt, wie eng europäische und amerikanische Kunst verbunden sind und wie stark sich künstlerische Ideen über Kontinente hinweg gegenseitig beeinflussen. In vielen Räumen steht das einzelne Bild im Mittelpunkt, in anderen verbinden sich mehrere Arbeiten zu thematischen Kapiteln, etwa zu Abstraktion, Figuration oder zu bestimmten Künstlergruppen. Manche Gemälde und Skulpturen gelten international als Unikate für Kunstsammler, Museen und Forschung, weil sie eine Schlüsselstellung im Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers einnehmen und kunsthistorische Entwicklungen exemplarisch verdichten.
Große Ausstellungen und internationale Resonanz
Neben der Dauerausstellung hat K20 in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder große Sonderausstellungen realisiert, die weit über die Region hinaus Beachtung fanden. Retrospektiven zu prägenden Künstlerpersönlichkeiten, thematische Ausstellungen zur Klassischen Moderne oder zu neuen Lesarten der Kunstgeschichte haben das Haus zu einem wichtigen Diskussionsort gemacht. Häufig wurden Werke aus internationalen Museen nach Düsseldorf geholt, während umgekehrt Leihgaben der Kunstsammlung weltweit unterwegs waren.
In jüngerer Zeit haben sich dabei verstärkt kuratorische Projekte entwickelt, die bekannte Kapitel der Moderne neu erzählen, etwa aus feministischer, postkolonialer oder queerer Perspektive. So entstehen Blickwechsel, die den historischen Bestand nicht nur bewahren, sondern immer wieder neu interpretieren und in Beziehung zu heutigen Fragestellungen setzen.
K21 im Ständehaus: Gegenwartskunst auf mehreren Ebenen
Vom Parlament zum Museum
Mit K21 im ehemaligen Ständehaus am Kaiserteich gelang der Kunstsammlung NRW zu Beginn der 2000er-Jahre ein zweiter großer Schritt. Das historische Gebäude, Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, war lange Sitz des Parlaments von Nordrhein-Westfalen. Nach dem Auszug des Landtages bot sich die Gelegenheit, das Haus einer neuen Nutzung zuzuführen. Nach einem umfassenden Umbau wurde es 2002 als Museum für internationale Gegenwartskunst eröffnet.
Die charakteristische Kuppel, das zentrale Atrium und die umlaufenden Galerien auf mehreren Ebenen machen K21 zu einem Ort mit starkem räumlichen Charakter. Die Architektur erlaubt es, Skulpturen, Installationen, Videoarbeiten und Bildserien in ganz unterschiedlichen Situationen zu zeigen – von intimen Kabinetträumen bis hin zu raumgreifenden Inszenierungen, die mehrere Etagen umfassen.
Installationen, Medienkunst und neue Formate
Inhaltlich konzentriert sich K21 auf Kunst seit den späten 1970er-Jahren. Fotografische Arbeiten, Video- und Medienkunst, komplexe Installationen und performative Formate bilden einen Schwerpunkt. Künstlerinnen und Künstler wie Thomas Schütte, Thomas Struth, Stan Douglas, Fiona Tan oder viele andere sind hier mit bedeutenden Werkgruppen vertreten. Auch große Rauminstallationen, die speziell auf das Ständehaus zugeschnitten sind, haben das Profil von K21 geprägt.
Besonders eindrücklich sind Projekte, die die besondere Architektur des Hauses nutzen, etwa die Bespielung der Kuppel oder die Hängung von Arbeiten im Luftraum der Piazza. Solche Inszenierungen machen die Grenzen zwischen Ausstellungsraum, Architektur und künstlerischer Arbeit durchlässig und lassen einen Besuch im K21 zu einem körperlichen Erlebnis werden. Das Museum versteht sich hierbei auch als Labor für neue Formen der Kunstvermittlung, in denen Gespräche, Workshops, Performances und digitale Formate miteinander verzahnt werden.
Das Schmela Haus: Avantgarde im Maßstab eines Stadthauses
Die Galerie Schmela und Düsseldorf als Kunststadt
Der dritte Standort der Kunstsammlung NRW, das Schmela Haus in der Düsseldorfer Altstadt, besitzt eine besonders enge Verbindung zur Nachkriegsgeschichte der Stadt. Ursprünglich wurde das Gebäude als Galeriehaus für Alfred Schmela errichtet, der seit den 1950er-Jahren zu den einflussreichsten Galeristen Deutschlands zählte. In seinen Räumen präsentierte er früh und konsequent internationale Avantgarde, darunter Yves Klein, Piero Manzoni und Joseph Beuys.
Mit diesen Ausstellungen trug die Galerie Schmela wesentlich dazu bei, dass Düsseldorf sich als Brennpunkt für aktuelle Kunst etablierte. Der Austausch zwischen der Kunstakademie, privaten Galerien und Sammlerinnen und Sammlern war dicht, und das Schmela Haus war ein wichtiger Treffpunkt dieser Szene. Als das Land Nordrhein-Westfalen das Gebäude später erwarb und der Kunstsammlung eingliederte, wurde die Geschichte einer privaten Avantgarde-Galerie auf besondere Weise in eine öffentliche Institution überführt.
Architektur von Aldo van Eyck und heutige Nutzung
Architektonisch ist das Schmela Haus ein Werk des niederländischen Architekten Aldo van Eyck, der das Gebäude Ende der 1960er-Jahre entwarf. Der turmartige Bau mit seinen verschachtelten Ebenen, Sichtbetonflächen und wechselnden Raumhöhen unterscheidet sich deutlich von klassischen White-Cube-Galerien. Statt neutraler Kästen bietet das Haus eine Folge von Situationen, die Ausstellungen immer wieder neu herausfordern.
In der Nutzung durch die Kunstsammlung NRW wurde das Schmela Haus vor allem für kleinere, experimentelle Projekte, Vorträge und Diskussionen eingesetzt. Die Nähe zur Straße, die überschaubare Größe und die markante Architektur machen das Gebäude zu einem idealen Ort, um neue kuratorische Ideen zu erproben, historische Themen im kleinen Rahmen zu vertiefen oder Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Initiativen der Stadt sichtbar zu machen.
Direktion, Sammlungspolitik und gesellschaftliche Verantwortung
Prägende Persönlichkeiten an der Spitze
Die Entwicklung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen lässt sich auch über die Direktorinnen und Direktoren nachvollziehen. Nach der langen Amtszeit Werner Schmalenbachs übernahmen unter anderem Armin Zweite, Marion Ackermann und später Susanne Gaensheimer die Leitung. Jede dieser Persönlichkeiten brachte eigene Schwerpunkte ein: von der Erweiterung der Klassischen Moderne über die Betonung der internationalen Gegenwartskunst bis hin zu einer stärkeren Vernetzung mit globalen Diskursen.
Unter ihren Leitungen haben sich Sammlung und Programm allmählich verschoben: hin zu einer breiteren geografischen Streuung der Künstlerinnen und Künstler, zu mehr Arbeiten von Frauen, zu neuen Medien und zu Fragestellungen, die gesellschaftliche Konflikte und Umbrüche widerspiegeln. Die Kunstsammlung NRW reagiert damit auf Debatten, die Kunstmuseen weltweit beschäftigen – etwa zu Diversität, Teilhabe und historischer Gerechtigkeit.
Erwerbungen, Schenkungen und internationale Kooperationen
Der heutige Bestand der Kunstsammlung NRW beruht auf gezielten Ankäufen, bedeutenden Schenkungen und langfristigen Leihgaben. Immer wieder konnten Schlüsselwerke erworben werden, die Lücken im historischen Profil schließen oder neue Linien eröffnen. Hinzu kommen Konvolute aus Künstlernachlässen, Kooperationen mit Stiftungen und Stifterinnen sowie Leihgaben, die über viele Jahre im Museum verbleiben.
Parallel dazu ist ein dichtes Netz internationaler Kooperationen entstanden. Ausstellungen werden gemeinsam mit ausländischen Museen geplant, Forschungsprojekte zu einzelnen Künstlern oder Themen lanciert und Bestände für weltweite Tourneen zur Verfügung gestellt. Die Kunstsammlung steht damit nicht nur im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern ist Teil eines globalen Austauschs, in dem Kunstwerke, Ideen und Forschungsansätze ständig zirkulieren.
Fazit und Ausblick: Eine Sammlung in Bewegung
Die Geschichte der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt, wie aus einem einzelnen, mutigen Ankauf ein komplexes Gefüge aus Häusern, Sammlungen und Programmen entstehen kann. Von den Klee-Werken der frühen 1960er-Jahre über den Bau von K20 und K21 bis zur Einbindung des Schmela Hauses zieht sich eine Linie, in der sich kunsthistorische Entwicklungen, kulturpolitische Entscheidungen und städtische Veränderungen gegenseitig beeinflussen.
Heute steht die Kunstsammlung NRW vor Aufgaben, die weit über die Pflege eines bestehenden Bestandes hinausgehen. Es geht um die Frage, wie Kunst im 21. Jahrhundert vermittelt werden kann, wie digitale Formate sinnvoll eingesetzt werden, wie Publikumsschichten erreicht werden, die bisher nur selten den Weg ins Museum gefunden haben, und wie ökologische und soziale Verantwortung ernsthaft in den Museumsalltag integriert werden. Zugleich bleibt die zentrale Aufgabe bestehen, Kunstwerke zu bewahren, zu erforschen und in immer neuen Zusammenhängen zu präsentieren.
Gerade in Zeiten schneller Veränderung erweist sich die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen als stabiles, zugleich bewegliches Gefüge. Die Häuser K20, K21 und das Schmela Haus verbinden historische Tiefe mit Offenheit für Experimente. Die Sammlung erlaubt es, zentrale Kapitel der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts nachzuvollziehen und immer wieder neu zu befragen. Damit bleibt die Kunstsammlung NRW ein zentraler Referenzpunkt für die Kunstszene des Landes, ein wichtiger Anziehungspunkt für internationales Publikum und ein Ort, an dem Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Kunst in einen fruchtbaren Dialog treten.