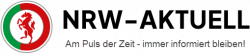Die UN Behindertenrechtskonvention verpflichtet alle Vertragsstaaten, Menschen mit einer Behinderung den gleichberechtigten Zugang zur allgemeinen Hochschulbildung und lebenslangem Lernen zu ermöglichen. Leider sieht der Alltag aber oft ganz anders aus: An vielen Hochschulen finden sich nach wie vor zahlreiche Barrieren, die behinderten oder chronisch kranken Studenten das Leben schwermachen. Berührungsängste zwischen behinderten und nicht-behinderten Studierenden erschweren den Inklusionsprozess zusätzlich.
Im März 2009 trat in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft. Diese legt fest, dass behinderte Menschen die gleichen Rechte wie alle anderen Bürger genießen und Anspruch auf eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft haben. In Rahmen der Konvention wurde auch der Begriff der sogenannten Inklusion geprägt, der seitdem immer wieder von Medien, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Organisationen thematisiert wird.
Was aber bedeutet „Inklusion“ überhaupt? Letztendlich meint der Begriff nichts anderes als das Prinzip, dass kein Mensch ausgegrenzt oder ausgeschlossen werden darf und einen gesetzlich gesicherten Anspruch auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität besitzt – was sich selbstverständlich auch auf den Bereich der Hochschulbildung bezieht.
Umsetzung oft noch in den Kinderschuhen
Allerdings bedeutet eine rechtliche Gleichstellung noch lange keine tatsächliche Gleichstellung: Viele Bildungsinstitute wie Universitäten und Fachhochschulen tun sich mit der praktischen Umsetzung der Inklusion schwer.
Fehlende Einrichtungen wie zum Beispiel Rampen, Aufzüge oder optische und akustische Hilfestellungen sind dabei nur ein Teil des Problems. Barrieren finden sich nicht nur im baulichen, sondern auch im strukturellen Bereich. So benötigen zum Beispiel viele behinderte Studenten aufwendige und zeitintensive medizinisch-therapeutische Behandlungen, welche auf Kosten der Lern- und Freizeit gehen und in den unflexiblen und auf Leistung ausgelegten Lehrplänen meist nicht berücksichtigt werden.
Auch im studentischen Alltag sind viele Strukturen nicht auf die Bedürfnisse von Behinderten ausgerichtet: So kann bereits der Weg zur Universität mit dem öffentlichen Nahverkehr oder das Mittagessen in der Mensa zu einer Herausforderung werden.
Erschwert wird der Inklusionsprozess aber nicht nur durch institutionelle Faktoren: Oft führt eine Behinderung zusätzlich auch noch zu einer Ausgrenzung durch die Kommilitonen. Dies geschieht in den wenigsten Fällen bewusst oder mit einer bösen Absicht: Vielmehr sind es Berührungsängste und mangelndes Wissen (vor allem) vonseiten der nicht-behinderten Mit-Studierenden, die den Kontakt erschweren und einschränken.
Dazu trägt aber auch die Tatsache bei, dass behinderte Kommilitonen aufgrund von physischen oder psychischen Einschränkungen oft von vielen Freizeitaktivitäten außerhalb der Hochschule ausgeschlossen sind. Ein Mangel an geeigneten Begegnungsstätten, welche die Chance zu gemeinsamen Erlebnissen bieten, erschwert den Austausch zusätzlich.
Inklusive Freizeitangebote schaffen Anknüpfpunkte
Genau an diesem Punkt setzt die an: Sie soll die Möglichkeit für persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung bieten. Diese bekommen so die Chance, die Lebensrealität des jeweils anderen zu erleben und Einblicke in den Alltag zu gewinnen. Hauptakteure der Kampagne sind Winfried und Mathias, die regelmäßig losziehen, um inklusive Freizeitangebote zu testen und ihre Erfahrungen anschließend in kleinen Filmen teilen.
Darüber hinaus bietet die Kampagne auch noch einen „Kulturfinder“, mit dem Interessierte inklusive Freizeitangebote in ihrer Umgebung finden können. Dieser beinhaltet unter anderem Sportstätten, Stadien, Kinos, Theater oder Museen.
Eines der langfristigen Ziele von „Zwei für alle Fälle“ ist es, zu mehr Offenheit und sozialem Engagement im Alltag beizutragen und so die Motivation zu erhöhen, sich auch persönlich für Inklusion einzusetzen. Der Ansatz „Inklusion durch gemeinsame Erlebnisse“ hat dementsprechend das Potenzial, diese Einstellung auch in die Hochschulen zu tragen und hier zur aktiven Umsetzung von inklusiven Prozessen beizutragen. Also: Schnappt euch eure Kommilitonen, sucht euch ein inklusives Freizeitangebot in euer Umgebung und macht eure eigenen Erfahrungen!